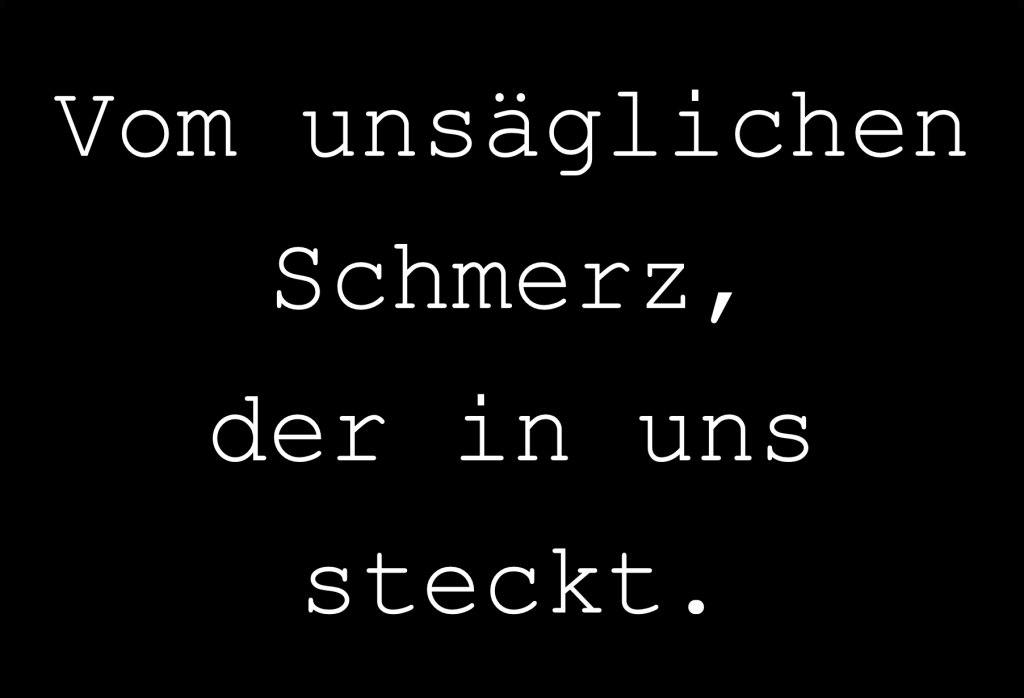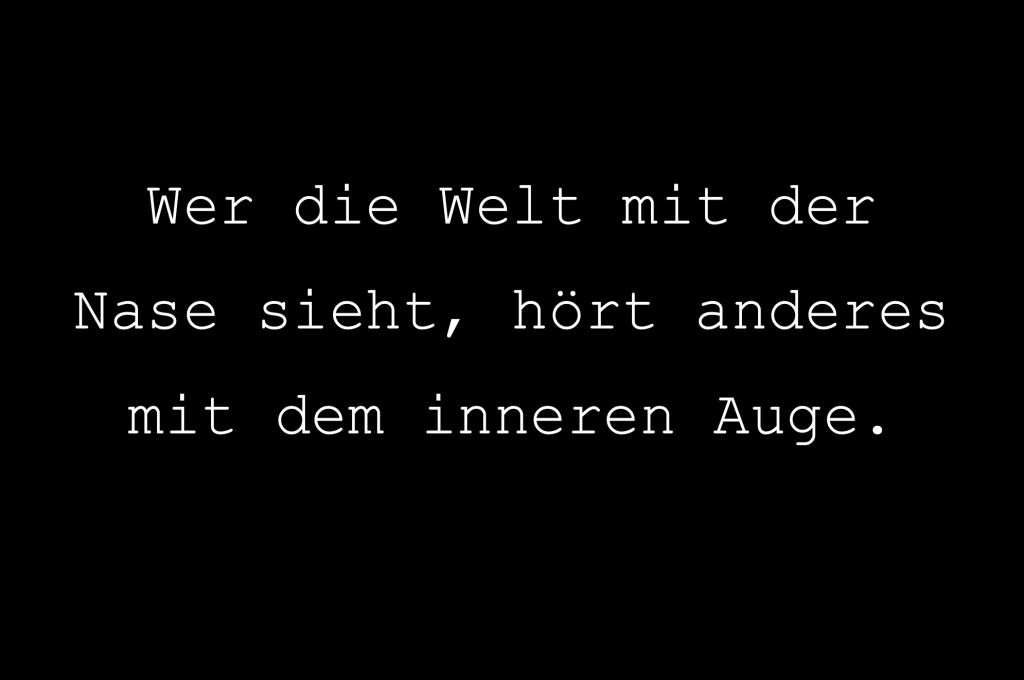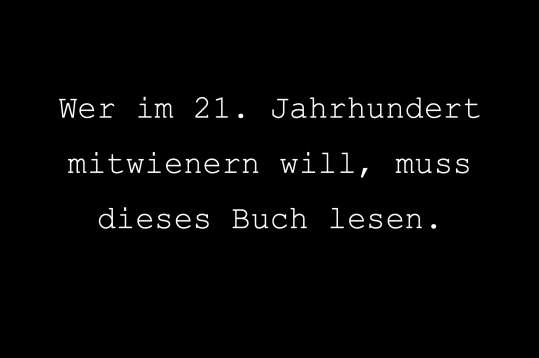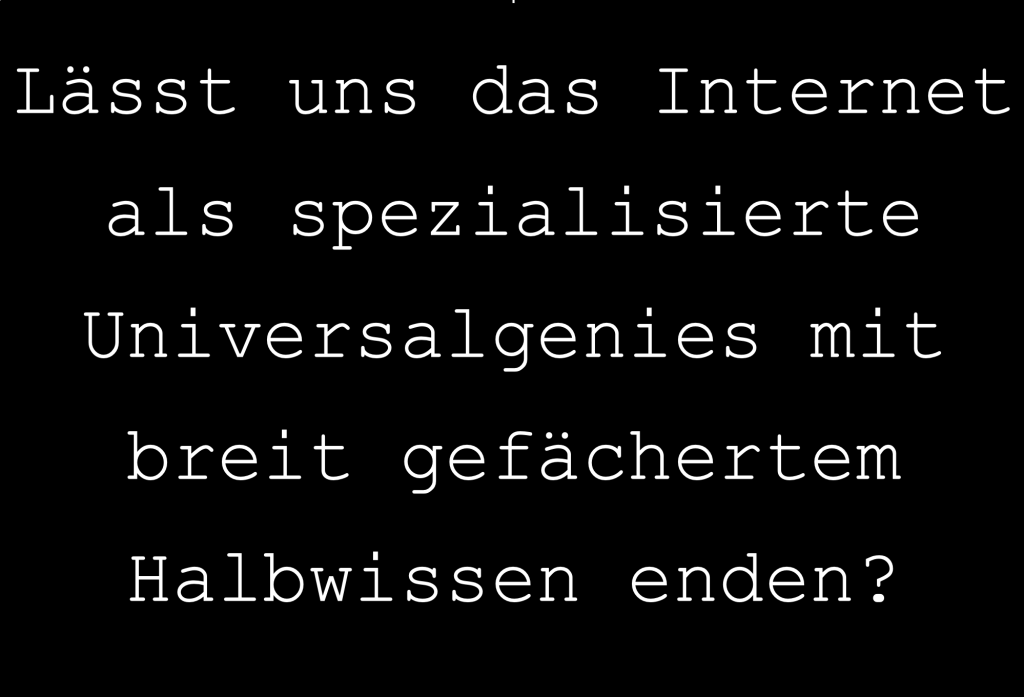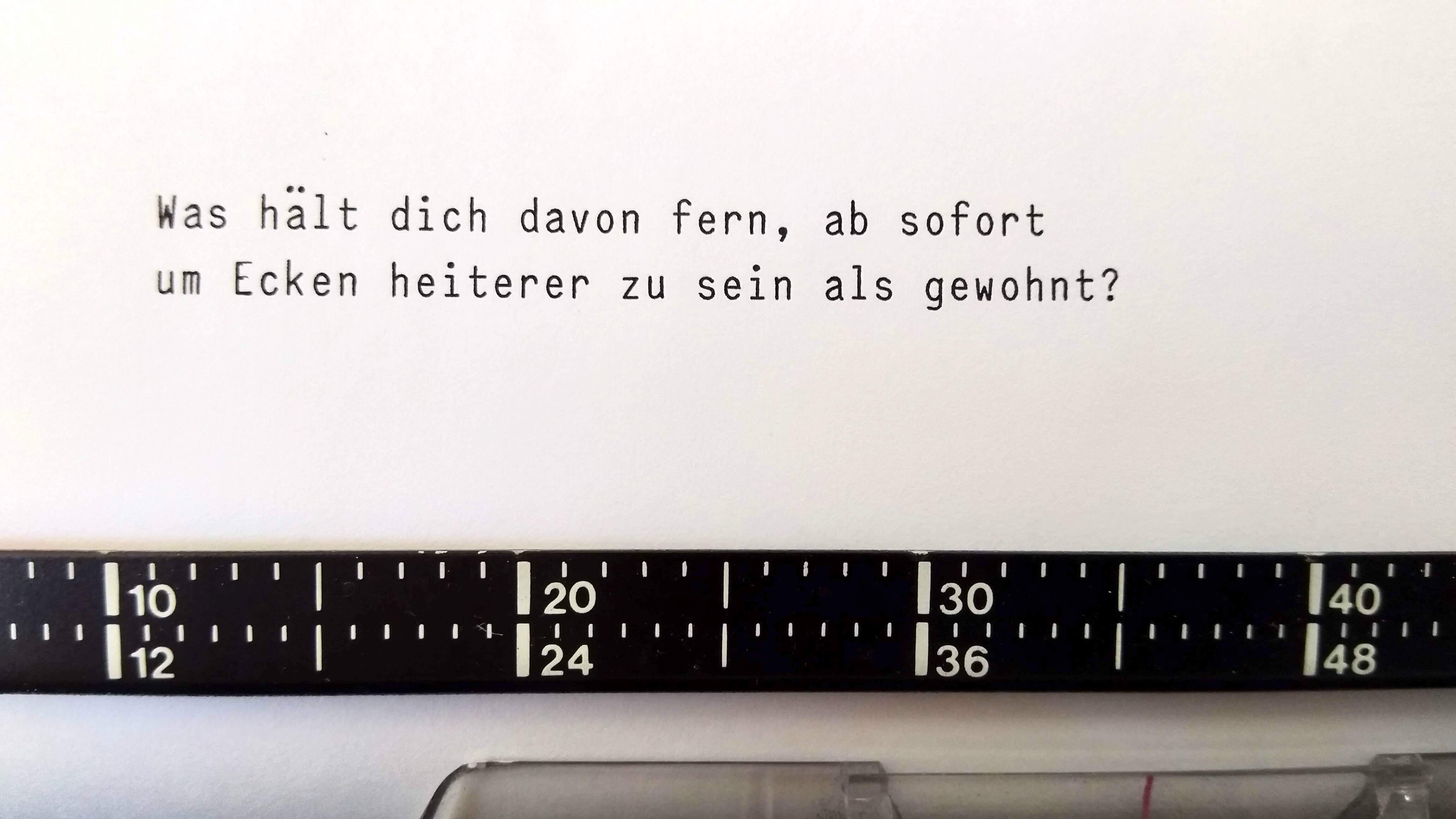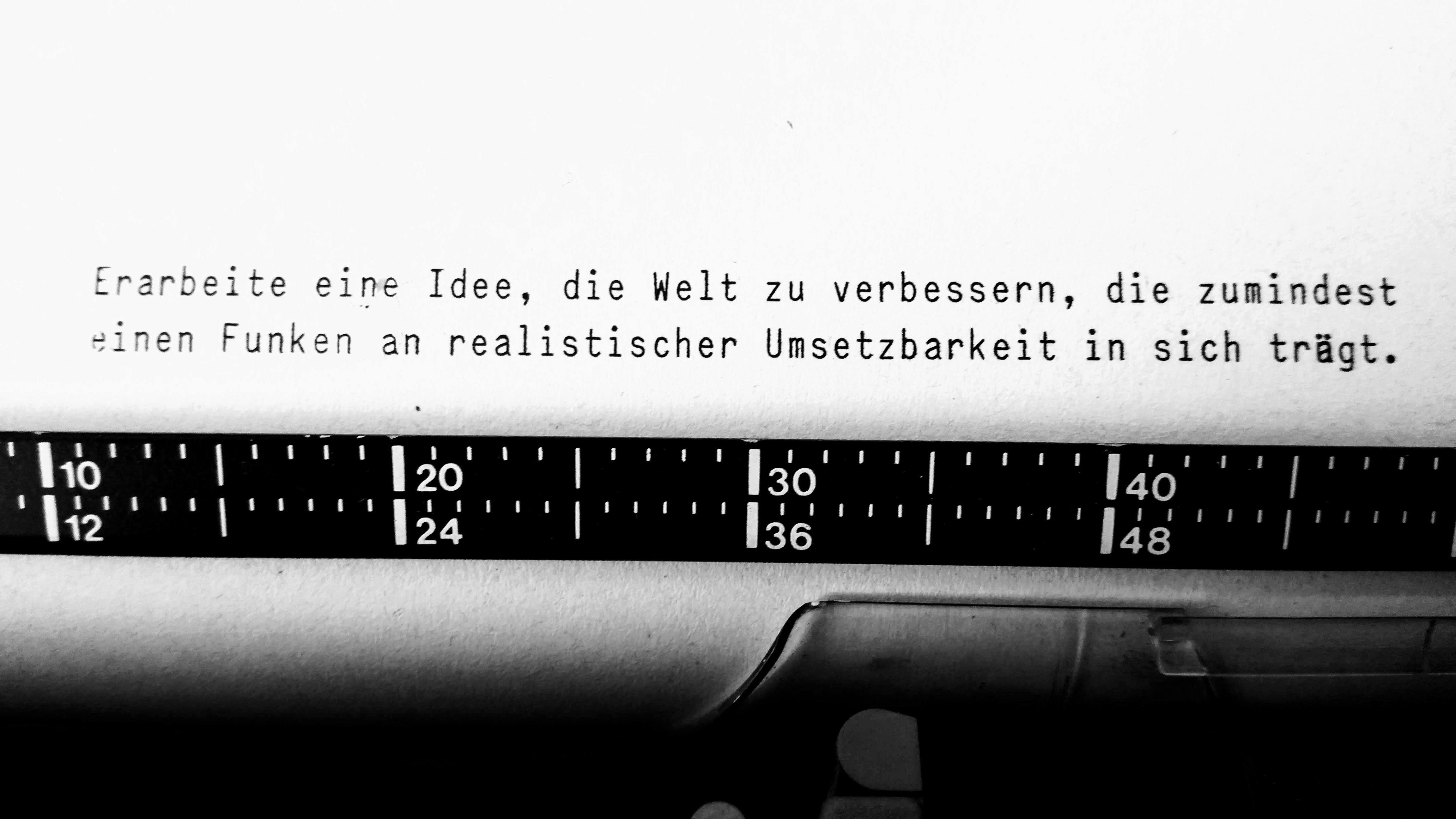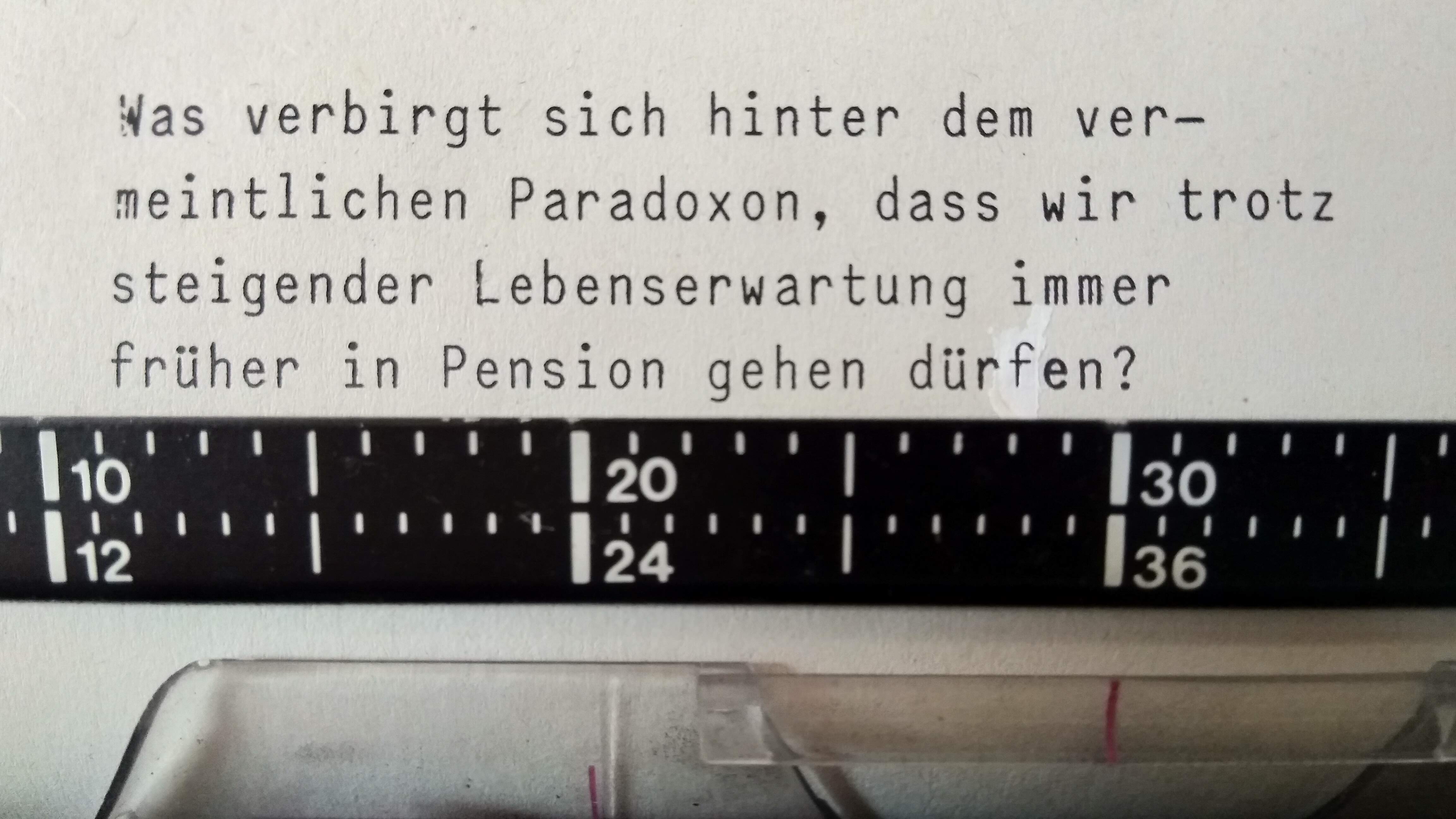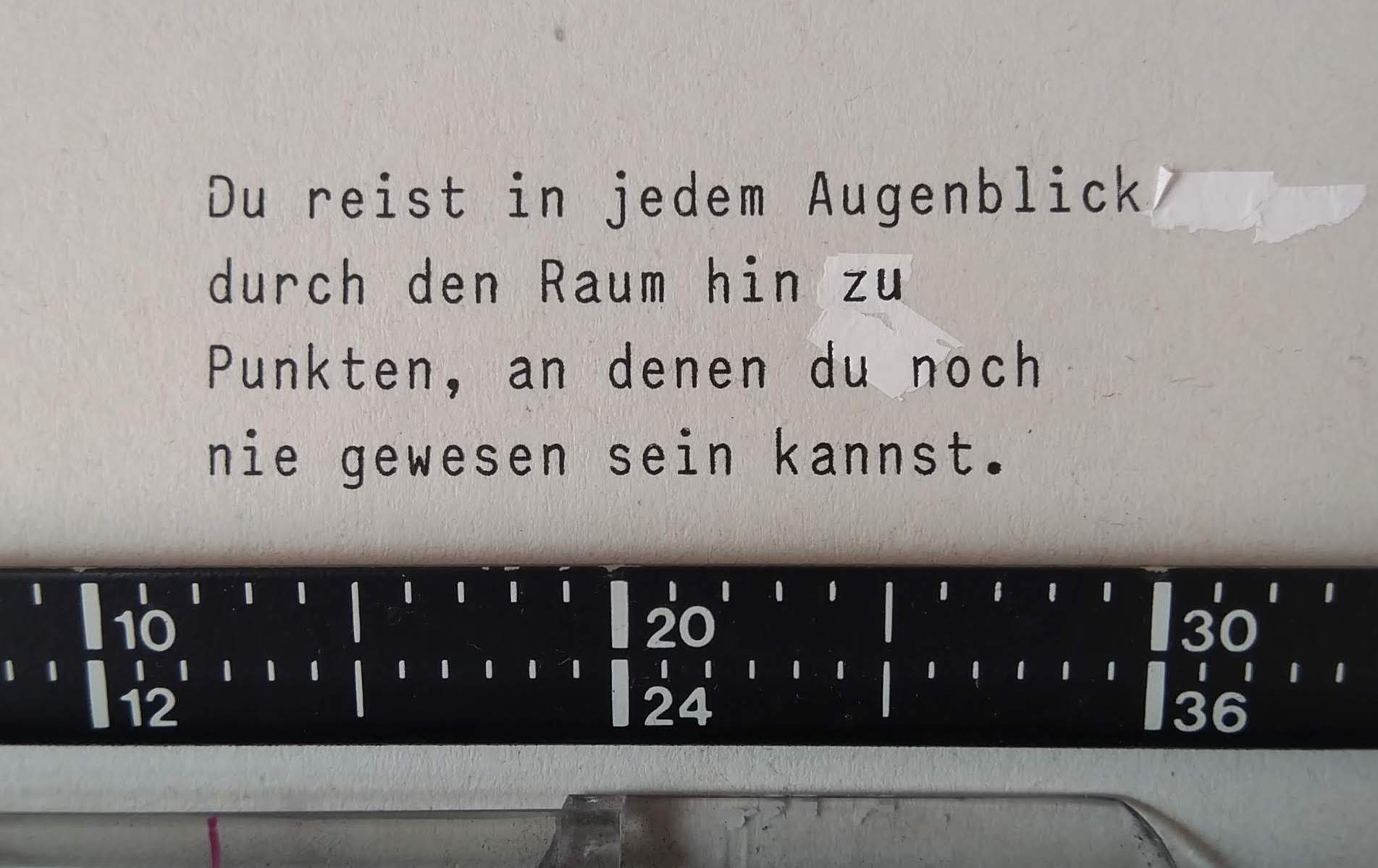Ein Aufruf, geschlechtergerecht eine gute Schreibe zu bewahren.

Gendern wird polemisch diskutiert. Manche sehen darin Teufelswerk, andere die Befreiung der Sprache vom Patriarchat. Das Deutsche, um mal Banales zu klären, unterscheidet natürliches und grammatikalisches Geschlecht. Eine Person kann faktisch auch männlich oder nichtbinär sein, obwohl das Wort „die Person“ grammatikalisch weiblich ist. Ähnlich das Kind oder der Mensch. Andere Sprachen, wie das Englische, haben dieses Problem nicht oder nur in minimalem Ausmaß, andere schon.
Es gibt überdeutliche Gründe, die in der Männerwirtschaft unserer Kultur zu finden sind, warum viele Wörter mit grammatikalischem (und natürlichem) männlichem Genus stellvertretend für alle Geschlechter stehen; das heißt, wo Frauen und diverse Landsleute ungefragt mitgedacht werden. Holzfäller, Henker, Kapitalist beispielsweise.
Nervensäge, Verkaufstalent, Flasche, Würstchen, Ekel, Lehrkraft sind zwar grammatikalisch weiblich respektive sächlich, bei mir bilden sich allerdings zuerst Bilder männlicher Exemplare der jeweiligen Gattung vor dem geistigen Auge, wenn ich diese Wörter höre.
Anders jedenfalls als bei Diva, Groupie, Cheerleader, wo bei den meisten – obwohl grammatikalisch feminin, neutral oder maskulin – wohl zuerst Bilder von Frauen im Kopf entstehen. Positive oder negative Konnotationen lassen wir mal außer Acht.
Die Frage ist, wie sich in Texten verhalten, ohne Frauen und nichtbinäre Persönlichkeiten mittels grammatikalisch männlicher Bezeichnungen in einen Topf zu werfen und Gefahr zu laufen, sie vor den Kopf zu stoßen.
Das ist nicht einfach für jene, die all die neuen Schreibvarianten mit Sternchen, Unterstreichungen, Doppelpunkten etc. als stilistisch unschön empfinden. Ich persönlich erachte, dass diese Varianten schriftlich, nicht aber gesprochen anwendbar sind.
Ich kann nur empfehlen, sich der Überfülle der deutschen Sprache zu bemächtigen und mit etwas gutem Willen Texte zu erarbeiten, die Stil bewahren und dennoch gegendert sind, ohne dass was auffällt. Wie bei diesen 2.000 Zeichen.